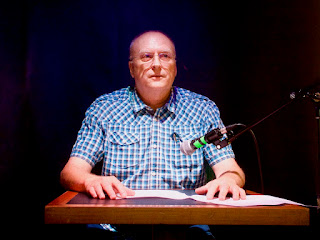Corinna Antelmann
Auch wenn als ungewiss gilt, wem die Zukunft des Geschichtenerzählens gehören, also ob die KI uns in Zukunft das Schreiben abnehmen wird, gewiss ist, dass Geschichten seit Menschengedenken erzählt wurden und dies auch weiterhin geschehen wird. Vielleicht nicht mehr am Lagerfeuer, dafür über Streaming-Dienste, wo sie mehr Menschen erreichen denn je. Und gewiss ist auch: Sie werden diese Menschen in der Tiefe nur dann berühren können, wenn sie nach wie vor von Menschen verfasst werden. Schließlich beschreiben Geschichten nichts Geringeres als Abschnitte unserer Lebensreisen, anders ausgedrückt: unseres Individuationsprozesses, wie Carl Gustav Jung ihn beschrieben hat: als Möglichkeit, uns im Laufe des Lebens weiterentwickeln zu können.
Bestenfalls.
„Der eigentliche Individuationsprozess – die bewusste Auseinandersetzung mit dem grösseren inneren Menschen oder dem eigenen Seelenzentrum – beginnt meistens mit einer Verwundung oder einem Leidenszustand, der eine Art von Berufung darstellt, aber oft nicht als solche erkannt wird. Das Ich fühlt sich vielmehr in seinem Willen oder Begehren behindert […]“[1]
Eben deshalb sind uns Schreiberlingen Konflikte und Krisen am liebsten (wenn auch nicht unbedingt im eigenen Leben!), denn freiwillig hat sich noch niemand entwickelt. Die Reise des Menschen führt ihn durch Beziehungen und Veränderungen, die auf Erfahrung basieren, niemals aber auf Daten, schließlich in die Erfüllung.
Es ist dieser Wunsch nach Erfüllung, oder auch: Erlösung, der uns laut Analytischer Theorie antreibt und sich in allen Erzählungen dieser Welt spiegelt.
So auch in Serien.
Lange Zeit galten Serien als ein unterhaltsames Fernsehformat, das für abendliche Gesellschaft sorgt, mit Personen, denen man beim Bügeln zuhören kann (hören, nicht sehen!). Nun aber feiern sie Hochkonjunktur, und hier ist es nahezu gleichgültig, ob es sich dabei um Serien handelt, die bereits in meiner Jugend über den Bildschirm flackerten oder um neue Produktionen von Netflix, Prime, DisneyPlus, die im Übrigen in der Filmbranche als das Innovativste gelten, was in den letzten Jahren produziert wurde.
Und nicht wenige von ihnen erreichen den Status von Kult, wie jedes Objekt, ob Tier, Baum, Ahne oder eben Film, das angebetet und in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wird. Kult ist alles, was über das Alltägliche herausgehoben wird, um es zu verehren, ihm zu huldigen, sich ihm hinzugeben und einzubetten in Rituale.
Den Fangemeinden ist es zu verdanken, wenn dies in Bezug auf eine Serie geschieht, aber das Bedürfnis nach Kult ist ein urmenschliches und findet sich, rein erzählerisch gesehen, nicht nur in der Liturgie wieder, sondern in jedweder Religion.
Erich Fromm sieht die Religion als ein System des Denkens und Tuns,
das von einer Gruppe geteilt wird und dem Individuum einen Rahmen der Orientierung und ein Objekt der Hingabe bietet[2],
und sieht dieses Bedürfnis nach Orientierung und Hingabe in der menschlichen Existenz selbst begründet.
Und so wage ich die These, dass sich in den Serien möglicherweise etwas findet, das eine beinahe religiöse Komponente hat, beziehungsweise sie in mancher Hinsicht ersetzt. In diesem Zusammenhang möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass die Anleitung, die Autori:nnen, die für Fernsehserien schreiben, eine Orientierung durch das Geflecht der jeweiligen Serie bieten soll, die Serien-Bibel heißt. Sie soll helfen, sich im Geflecht um Abraham und seine Söhne, pardon, Captain Kirk und seiner Crew, oder FBI-Agent Dale Cooper und den Bewohner:innen von Twin Peaks, zurechtzufinden.
Trägt serielles Erzählen also tatsächlich Merkmale einer Religion?
Ein Merkmal der Serie ist es, dass sie den Geschichten erlaubt, immer weiter erzählt werden zu können, über Jahrzehnte hinweg, ohne vorhergedachten Endpunkt, weiter und weiter und weiter, bis ... es langweilig wird? ... es nichts mehr zu erzählen gibt? … der Untergang kommt? ... oder die Erlösung (wie oben beschrieben)?
In gewisser Weise also liefern Serien das Versprechen der Unendlichkeit, und erfüllen so den Traum der Menschen, ihre Geschichte immerfort weiterspinnen zu können, solange, bis ... es langweilig wird? … es nichts mehr zu erzählen gibt?
Die Furcht vor dem endgültigen Ende katapultiert uns mittenhinein in die großen Fragestellungen, weil niemand sagen kann, was uns erwarten wird nachdem Nachdem. Die Furcht wie die Frage determinieren das Leben, und alle Menschen haben zu jeder Zeit nach Antworten gesucht haben und suchen sie noch immer. Den Tod vor Augen erfährt der Mensch seine Begrenzung und sucht nach einer Idee, einem Ideal, nach etwas, das über das Ende und über das rein Körperliche hinausgeht. Vermutlich ist Religion aus diesem Grund eine universale geschichtliche Erscheinung, denn sie liefert uns den befriedigenden Befund, es gäbe dieses Mehr und damit auch eine Antwort auf die Frage nach dem Ende. Oder den beruhigenden Befund: Das Ende ist immer nur ein Anfang.
Aber bitte, bitte, kann es nicht noch ein bisschen weitergehen?
Ungeachtet des Todes?
Um dem Sterben zu entgehen, nutzt Schahrasad die bekanntesten Cliffhanger überlieferter Erzähltradition, auf dass es auch für sie weitergehen möge. In der ersten von tausendundeiner Nacht bricht sie ihre Geschichte in dem Moment ab, als der Geist das Schwert hebt, um den König zu töten. Der König Schahriyar verlangt nach Fortsetzung. Und sie verspricht, dass ihre Erzählung morgen Nacht noch viel schöner und viel spannender sein werde als alles, was sie heute erzählt habe.
Da sprach der König zu sich selbst: „Ich werde sie, bei Gott, nicht eher töten, bis ich die Geschichte zu Ende gehört habe.“[3]
Im Falle der Serie ist die Frage nach dem Ende leichter zu beantworten als im Leben: Sie endet, sobald sie nicht mehr verkauft werden kann; sobald niemand mehr darauf reagiert, wenn es heißt: „Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Doktor Bob sagen hören wollen: Wohl denn, Gevatter Schwein, ich kenne euch sehr wohl“, kurz: Sie endet, sobald die Lebenszeit der Erzählung abgelaufen ist. Aber selbst Doktor Bob von der Muppet-Show wird möglicherweise wiederbelebt, sei es auf YouTube, in einer Neuverfilmung, als Buch, App oder DVD. Ja, es gibt sie, die Wiedergänger und Totgeglaubten, die nach Jahrzehnten auferstehen und mit geballter Vitalität ihre Leben zurückfordern - als Beispiele seien genannt: Raumschiff Enterprise oder James Bond, von den ersten Folgen bis zu den heutigen im steten Wechsel. Und auch gegenwärtig erfolgreiche Serien werden eines Tages möglichweiser wiederauferstehen, nachdem sie bereits abgesetzt wurden. Sie leben solange, wie noch jemand an sie glaubt.
Die Umtriebigkeit der Serien-Fans, die sich, nach Lieblingsserien getrennt, im Netz tummeln, erhält diesen Glauben am Leben und ist immens. Alle haben ihre eigenen Seiten, um ihre Lieblingsserie zu feiern, doch geeint sind sie in dem Wunsch, den immer gleichen Ablauf in einem immer gleichen Setting zu zelebrieren, in dem sich die immer gleichen Menschen versammeln: Hier wird der heilige Text neu gelesen, neu interpretiert, neu gedeutet. Zugleich wird dabei das Bedürfnis nach Wiederholung gestillt, wie es schon in Ritualen der Stammeskulturen, die als Vorläufer der gängigen Religionen gesehen werden, gelebt wurde: in kultischen Handlungen, die der Anbetung des jeweils erwählten Objektes dienen. Vermutlich ist es kein Zufall, dass jede Fangemeinde ihren eigenen Stamm bildet - mit eigenen Ritualen (ja, es gibt sogar Stammeskämpfe).
Und auch das Bedürfnis, sich etwas zu widmen, dem mehr Bedeutung verliehen werden soll, um über das Alltägliche hinauszureichen, erfährt eine gewisse Befriedigung, wenn sich Gleichgesinnte zu einer zeremoniellen Wanderung treffen, bei der sie - zum Beispiel im Falle von Der Herr der Ringe, verkleidet als Elbe oder Ork, mit aufgeklebten Ohren oder gezogenem Schwert - durch das Mühlviertel marodieren und dabei einem Werk huldigen, das sie selbst zu dem gemacht haben, was es inzwischen ist: Kult.
Herr der Ringe entspricht im Übrigen keinem Serienformat, das sich endlos ausdehnen ließe, eine Bibel ist daher nicht vonnöten. Es reicht die literarische Vorlage, die verfilmt werden soll, womit ich zum Thema dieses Abends überleite: Der Literatur, die uns als Dreiteiler (mit drei Kinokartenverkäufen) oder als Mini-Serie präsentiert wird, bietet die Serie Raum zum Atmen, da sie sich über einen längeren Zeitraum entfalten darf, während Romanverfilmungen, in neunzig Minuten Kino gepresst und den Gesetzen der dramatischen Einzelerzählung unterworfen, selten genug gelingen. Und obwohl dem literarischen Stoff, anders als der episodenhaft erzählten Serie, doch ähnlich den Serien mit einem staffelumfassenden Spannungsbogen, ein Ende der Geschichte immanent ist, erfreuen wir uns hier wie dort am seriellen Erleben. Denn wenn wir Krieg und Frieden in acht Teilen schauen, lässt uns die Frage am Ende jeder Folge, ob der Frieden wohl siegen werde, am nächsten Tag wieder einschalten.
Auch der Frieden entspricht ja einer ur-menschlichen Sehnsucht, wenngleich die Menschheit sich schwertut, sich dorthin zu entwickeln, wo er sich einzulösen verspricht. Eben dafür braucht es die Geschichten, vor allem aber braucht es die Bereitschaft zur Individuation von uns Reisenden. Und es braucht Rituale, die den Wunsch nach dem Darüberhinaus ausdrücken, nach etwas, das uns transzendiert. Sorgen wir also für Objekte, die der Hingabe wert sind, für Geschichten, die sich dem Menschlichen verpflichtet sehen, geschrieben von Menschen, die ihre Erfahrungen und Gefühle in einem inneren Prozess in eine künstlerische Form transformieren.
Um noch einmal Erich Fromm zu bemühen:
Die Frage lautet nicht: ob Religion oder nicht?, sondern: welche Art der Religion? Fördert sie die Entwicklung des Menschen, die Entfaltung der spezifisch menschlichen Kräfte oder lähmt sie seine Kräfte.[4]
Ich zum Beispiel habe seit den Missionen von Raumschiff Enterprise allem vertraut, was uns in unendliche Weiten führt, meine Religion aber ist seit jeher die Literatur, gern auch als Serie. Und neulich, auf einer Lesereise im Harz, lief ich den Goetheweg bis zum Brocken hinauf. Schließlich habe ich den Faust mehrfach gelesen, zumindest in Auszügen.
Verkleidet habe ich mich nicht.